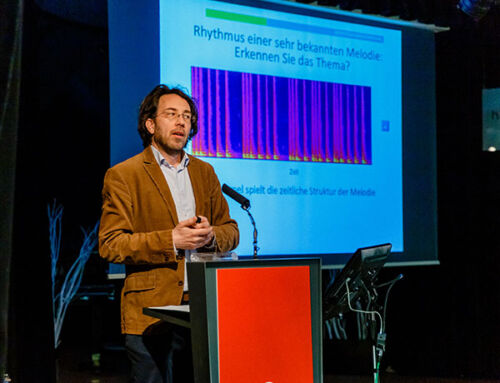“Lieblingsmusik sollte im Pass stehen”
Univ. Prof. Dr. Christoph Reuter, Vorstand des Instituts für Musikwissenschaft an der Universität Wien, spricht über das Wesen von Musik, ob sich Musikgeschmack messen lässt und was Musik mit Sprache zu tun hat.
1870 wurde an der Universität Wien der Lehrstuhl für Geschichte und Ästhetik der Tonkunst geschaffen, der Vorläufer des heutigen musikwissenschaftlichen Instituts. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Musik umfasst drei Bereiche: die Musikgeschichte, die Ethnomusikologie und die systematische Musikwissenschaft. Letztere widmet sich der musikalischen Akustik, der musikalischen Entwicklung und der Wirkung von Musik.
Seit 2016 ist Univ. Prof. Dr. Christoph Reuter Institutsvorstand: „Die Wiener Musikwissenschaft ist eine der wenigen Institute, an denen alle drei Fachrichtungen gut vertreten sind. Da wird man nicht so leicht betriebsblind.“ Durch den täglichen Austausch zwischen den drei Disziplinen seien sich Lehrende und Studierende der unterschiedlichen Perspektiven bewusst.
Musik – ein „geordnetes Geräusch“
In der Vitrine des Pausenraums präsentiert das Institut einige Exemplare der Sammlung unterschiedlicher Musikinstrumente: neben einer alpenländischen Maultrommel und einigen Flöten aus verschiedenen Ethnien auch ein Schwirrholz aus Papua Neuguinea. Das wird an einer langen Schnur im Kreis geschwungen und erzeugt dabei einen Klang, der von der Form des Schwirrholzes und von der Drehgeschwindigkeit abhängt. Reuter schmunzelt: „Die Abendländische Kultur ist nicht die einzige, die Musik macht. Andere Ethnien haben oft auch andere Zugänge zu Musik. Deren Musik beruht teilweise nicht auf harmonischer Basis, sondern eher auf Rhythmen; oder auf solchen Melodien und Intervallen, die Reibung erzeugen.“
Der gemeinsame Rahmen für diese unterschiedlichen Arten von Musik: „Geordnetes Geräusch. Einzelne Töne einer Trompete ergeben noch keine Musik, erst wenn sie miteinander in Beziehung gesetzt werden.“ Der Wissenschaftler verweist auf den österreichischen Philosophen Christian von Ehrenfels, der 1890 in seinem Aufsatz „Über Gestaltqualitäten“ formulierte: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Die Beziehung der Teile zueinander erkannte Ehrenfels als dieses Mehr. Reuter will Ehrenfels´ Theorie auch auf akustische Phänomene bezogen wissen: „Sobald man eine sinnvolle Beziehung zwischen Geräuschen herstellen kann, fängt es an, Musik oder Sprache zu werden. Sprache übermittelt dabei konkrete Information, Musik ist eher ein Emotionsmodulator.“
„Das Ohr kann man als Erweiterung der Haut betrachten, die im Lauf der Entwicklung immer feiner geworden ist. Über die Haut lassen sich – ähnlich wie beim Gehör, jedoch vor allem in tiefen Frequenzbereichen – Vibrationen wahrnehmen.“ Damit ist es auch tauben Menschen möglich, Musik zu genießen, selbst ohne die Melodie dabei wahrzunehmen – wenn auch andere Musik als hörende Menschen oder CI-Nutzer. „Es gibt Kulturen, die hauptsächlich mit Rhythmen arbeiten“, betont Reuter. Die individuelle Erwartungshaltung bestimme, was letztlich das Wesen von Musik ausmacht.
Frühes Hören
„Es gab ein Experiment mit Müttern, die während ihrer Schwangerschaft häufig die amerikanische TV-Serie Neighbours geschaut hatten. Nach der Geburt konnten die Neugeborenen die Titelmelodie dieser Serie erkennen“ Schon bei Neugeborenen kann man in sogenannten Habituations-Experimenten untersuchen, ob Babys einen Reiz wiedererkennen: Bei Neuem dreht ein Baby den Kopf in die Richtung des Gehörten oder verändert die Intensität oder Frequenz des Saugens am Schnuller. „Wenn die Neugeborenen dieser Mütter die Titelmusik hörten, änderte sich weder ihr Saugreflex noch wandten sie sich dem Gehörten zu. Daraus kann man schließen, dass den Babys die Musik schon bekannt war.“
Erstes Hören beginnt im Mutterleib. Ab der sechsten Schwangerschaftswoche bildet sich das Ohr aus, ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat können Embryos hören. Im Mutterleib hören sie durch
Bauch und Fruchtwasser hindurch gedämpft, vor allem die tiefen Frequenzen. „Mozart vorspielen, damit das Kind schlau wird, das ist Quatsch: Komplexe Beziehungen der Töne untereinander können Embryos nicht einordnen; dafür aber die Modulationen der Stimme und die verschiedenen Periodizitäten wie Schritte, Herzschlag oder Atmen. Und natürlich, wenn diese Periodizitäten gestört werden.“ Über den Stoffwechsel erleben Ungeborene den Gefühlszustand der Mutter mit und verknüpfen ihn mit dem Gehörten. „Man nimmt relativ früh mit, dass periodische Bewegungen vor allem Sicherheit verkörpern. Wenn sich die Mutter aber aufregt, der Herzschlag plötzlich schneller wird, die Atmung abrupter, die Stimme höher und die Sprachmelodie wechselhafter, dann erfährt das Kind, dass eine Störung der Periodizität mit körperlicher Anspannung oder Alarmbereitschaft einhergeht.“
„Das Ohr vermittelt Objektkonstanz“
Auch Stimmen kann der Embryo hören, besonders direkt jene der Mutter. „Unmittelbar nach der Geburt kann das Kind die Mutter an der Stimme erkennen und von anderen Frauen unterscheiden.“ Eine Fähigkeit, die zur emotionalen Sicherheit der Babys beiträgt: „Wenn bei einem Baby die Mutter nicht sichtbar ist, dann ist sie zunächst tot für das Kind“, beschreibt Reuter das Gefühlsleben Neugeborener. „Wenn die Mutter aus dem Sichtfeld verschwindet, aber dabei singt oder spricht, dann weiß das Kind: Die Mutter ist in der Nähe.“
„Das Ohr vermittelt Objektkonstanz. Hören vermittelt ein Gegenüber, vor allem aufgrund von Rhythmen und von Tonmodulation. Wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum uns Musik so sehr berührt“, vermutet Reuter.
„Musik soll in kontext-adäquate Situation versetzen.“
Der Übergang von Musik über Informationsaustausch zu Sprache ist fließend. Neben syntaktischen Informationen, beispielsweise Fragen, kommunizieren wir im Deutschen mit der Satzmelodie vor allem unseren emotionalen Zustand, sowie die persönliche Einstellung zum Gesagten: wie durch Ironie oder Zynismus. Bei tonalen Sprachen, wie dem Mandarin, geht eine Änderung der Tonhöhe oder des Tonverlaufs in einer Silbe mit einer Bedeutungsänderung des entsprechenden Wortes einher. Wenn die Tonhöhe informationstragende Bedeutung hat, trainieren Kinder ihr Gehör früh. Reuter dazu: „Es gibt seit den 2000er Jahren Veröffentlichungen, dass absolutes Gehör bei tonalen Sprachen besonders stark verbreitet ist.“
„In unserem Sprachbereich schwingt in der Tonhöhe und Sprachmelodie der emotionale Gehalt der Sprache mit, was sich in der Musik dann widerspiegelt.“ Eine Studentin Prof. Reuters untersuchte in ihrer Masterarbeit die klanglichen Merkmale von Freude in westlicher und in chinesischer Musik: „Beiden gemeinsam ist ein schnelles Tempo. Während es in der westlichen Musik darüber hinaus vorwiegend um Durtonarten und entsprechende Intervalle geht, wird bei chinesischer Musik Freude meist durch stark perkussive Geräusche, also Schlaginstrumente, ausgedrückt.“
In gedrückter Stimmung bevorzugen Menschen traurige Musik. Trauer wird in der westlichen Musik durch langsames Tempo, Moll-Tonarten, gedämpfte Klänge oder das sogenannte Seufzer-Motiv, absteigende Halbtonschritte, ausgedrückt. „Musik vermittelt damit ein verständnisvolles Gegenüber. Traurige Musik erzeugt dabei eine Art kathartischen Effekt, der die eigene Trauer erleichtert und erträglicher werden lässt.“
Was Musik beim Menschen auslöst
Reuter verweist auf Geräusche der Natur: Wind, Blätterrascheln oder Wasserplätschern – akustisch gesehen Varianten von Rauschen ohne bestimmte Tonhöhe. Sobald etwas mit einer konkreten Tonhöhe erklingt, wie der Schrei eines Tiers oder eine Alarmsirene, erhält es eine Signalwirkung, die Aufmerksamkeit erzeugt und häufig auch beunruhigt. „Wenn so ein Signal in einen sinngebenden Zusammenhang gebracht wird, wie etwa bei einem Musikstück, dann vermittelt das Gehörte die Botschaft: Du kannst dich entspannen, es ist alles in Ordnung.“ Wer weitere Elemente der jeweiligen musikalischen Syntax versteht, kann auch weitere Botschaften entnehmen: etwa in der abendländischen Musik das Quint-Intervall abwärts im Bass, das eine Zäsur kennzeichnet. In weiterer Folge lässt sich auch der festliche, unterhaltende, traurige Charakter eines Werkes jeweils zuordnen.
Ob traurig-sentimental oder fröhlich-beschwingt – für Musikproduzenten ist der kommerzielle Erfolg vorrangig. Im Vorfeld des Eurovision Song Contests 2015 in Wien wollte der ORF vom Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Wien wissen, welche Gewinnchancen der österreichische Beitrag haben werde. Zur Untersuchung solcher Fragestellungen kann bei Test-Hörern die körperliche Reaktion auf Musik gemessen werden: Herzschlag, Muskeltonus und Hautleitwert. „Der Hautleitwert ist im Grunde wie ein Lügendetektor-Test. Mit ihm lässt sich die emotionale Involviertheit eines Hörers in ein Musikwerk messen”, erklärt Reuter. Bei Musik werde die meist durch abrupte Wechsel erhöht. Überraschungsmomente quasi, Abweichungen von der Norm, die aber noch als systemkonform empfunden werden. Reuter ergänzt: „Auch der Text spielt eine große Rolle.“ Von jenen Beiträgen 2015, die zum Zeitpunkt des Tests schon bekannt waren, gab Reuters Team übrigens dem italienischen Beitrag von Il Volvo die besten Chancen – und der landete tatsächlich auf Platz drei.
Manche Geräusche gehen zwar ebenfalls unter die Haut, doch nur weil sie besonders unangenehm sind. „Babys wissen genau, welchen Bereich sie ansprechen müssen, um auch wirklich gehört zu werden“, lacht Reuter. In einer Forschungsarbeit beschäftigt er sich speziell mit unangenehmen Geräuschen. Die haben fast alle eine klar erkennbare Tonhöhe, sowie einen starken Frequenzanteil zwischen zwei und vier Kilohertz. Das ist jener Bereich, in dem Schall durch die Resonanz unseres Gehörgangs besonders stark übertragen wird. Quietschende Reifen oder die Kreide an der Tafel lösen damit direkte körperliche Reaktionen beim Hörer aus, und auch Babys nutzen dieses Frequenzband, um gut gehört zu werden. Angeführt wird die Weltrangliste unangenehmer Geräusche aber von einem Geräusch, dem diese Merkmale fehlen: „Beim Geräusch von Kotzen lösen eher Assoziation und Ekel das unangenehme Gefühl aus.“
„Musik soll Freude machen!“
Assoziationen spielen auch beim individuellen Musikgeschmack eine Rolle. „Schön ist meistens das, was man gewohnt ist“, fasst Reuter das Ergebnis zahlreicher Studien zusammen. Hinzu kommt der Kontext, in dem man bestimmte Musikstücke gehört hat. „Bei Musik werden sehr viele außer-musikalische Informationen abgespeichert, die mit dieser Musik verknüpft werden. Wenn man ähnliche Musik hört, werden die hervorgerufen.“
„Wenn man bestimmte Schlüsselwerke findet, die für den Betroffenen emotional bedeutsam waren, kann man Alzheimerpatienten wieder in die Interaktion zurück holen und sogar zum Mitsingen motivieren, selbst wenn das Sprachzentrum schon sehr stark in Mitleidenschaft gezogen ist“, erläutert Reuter eine Therapiemöglichkeit für Demenzkranke. „Man müsste eigentlich in den Pass schreiben, was so die jeweiligen Lieblingsstücke sind. Im Moment ist es eher eine Glücksache, ob man die findet.“
Musik wird vermehrt therapeutisch eingesetzt. Intelligenz fördernde oder mindernde Wirkung von Musik verneint Reuter aber: „Musik soll in erster Linie Freude machen.”