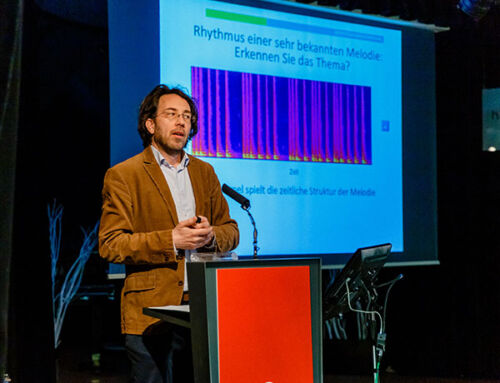Musik beeinflusst Hormone und Hörvermögen
Musik spielt seit der frühen Evolution der Menschheit eine bedeutende soziale Rolle. Durch ihre Auswirkungen auf die neuronalen Strukturen kann sie auch relevante Hilfe beim Hörtraining sein.
„Das Hörorgan ist eigentlich ein Schutzorgan. Früher war es die wilde Natur, heute ist es der Straßenverkehr, den es uns vermittelt“, so Prof. Dr. Patrick Zorowka bei seinem Vortrag im Zuge der Veranstaltung der Hören Bewegt Initiative im Frühling 2019 im Haus der Musik in Wien. Der HNO-Spezialist und Phoniater Prof. Zorowka leitet die Klinik für Hör-, Stimm- und Sprachstörungen der Universitätsklinik Innsbruck, wo er auch zahlreiche CI-Nutzer betreut. Natürlich hat das Gehör eine wesentliche Rolle bei der lautsprachlichen Kommunikation, die im Alltag immer noch die gebräuchlichste Kommunikationsform ist. Aber auch Musik hat seit der Frühzeit der Menschen einen wesentlichen sozialen Aspekt.
Manche Wissenschaftler halten die Entwicklung von Musik für reinen Zufall. Der Evolutionsforscher R. M. Dunbar stellte hingegen die Theorie auf, die Gruppen, in denen der frühzeitliche Mensch lebte, hätten irgendwann eine kritische Größe überschritten. Lausen sei für den Gruppenzusammenhalt dann nicht mehr ausreichend gewesen, Sprache und musikalische Äußerungen hätten diese Rolle übernommen.
Heute ist Musik ein Kulturgut. Die individuelle Präferenz bestimmter Musikstile variiert je nach Alter und lokaler Region, aber auch in Abhängigkeit von der sozialen Schicht. Im Lauf des Lebens werden aber auch individuelle Erlebnisse mit einer bestimmten Melodie oder einem Musikstück verknüpft, sodass diese Musik uns dann bewusst oder unbewusst an bestimmte Ereignisse erinnert. Das geht bis zu vegetativen Reaktionen, wenn es uns etwa „kalt den Rücken hinunter läuft“. Die Basis dazu wird schon sehr früh gelegt.
Musik entsteht im Kopf
Der normalhörende Mensch beginnt zwischen der 22. und 24. Schwangerschaftswoche zu hören. Von Beginn an spielen melodische Sequenzen eine wesentliche Rolle. So pflegen nicht nur Mütter im Umgang mit Neugeborenen meist automatisch eine markante Stimmmelodie. Diese ist eine wichtige, sprachliche Entwicklungsvoraussetzung. Andererseits ist die melodische Stimme als Tonmelodie ein wesentliches Merkmal von Musik.
Von Geburt an können wir prinzipiell alle Laute unterscheiden. Je nach Kulturkreis prägen sich dann jene Laute ein, die wir brauchen; die anderen werden quasi gelöscht. Chinesisch oder Arabisch beispielsweise sind in ihren Lauten ganz anders angelegt als die deutsche Sprache.
Die Schallverarbeitung geht vom äußeren Ohr über Mittel- und Innenohr. Dort wandeln 3500 Sinneszellen den Reiz in ein Nervensignal um. Die akustischen Informationen, die dabei über Sprache oder Musik übertragen werden, werden erst im Gehirn verarbeitet und als solche erkannt. Das Gehirn abstrahiert aus den relativ spärlichen Informationen der paar Tausend Sinneszellen erstaunlich viele Informationen, die Abstraktion von Sprache oder Musik. In unserem Gehirn sind jeweils bestimmte Regionen für klar definierte Sinneseindrücke vorgesehen, das können wir mit modernen Untersuchungsmethoden gut beobachten.
Musik, Kokain und Sex
Bei der Verarbeitung von Sinnesreizen arbeiten die einzelnen Teile unseres Gehirns jeweils sehr spezialisiert. Man könnte das mit der Autoproduktion vergleichen, bei der jeder Teil in einem anderen Bereich hergestellt wird, jeder für sich in hoher Qualität.
So besteht unser Gehirn aus zwei Hirnlappen. Beim Hören ist die linke Hirnseite für die zeitliche Analyse zuständig, die rechte für die Tonhöhenunterscheidung. Im sekundären Hörzentrum werden komplexe Muster verarbeitet. Noch höher im tertiären Zentrum, dem sogenannten Wernicke-Zentrum, sitzen die Assoziationsstrukturen. Der große Balken, die neuronale Verbindung zwischen den beiden Hirnlappen, dient zum Informationsaustausch zwischen den beiden Seiten. Im Zwischenhirn werden die Emotionen im limbisches System verortet, das Kleinhirn ist für die Koordination der Motorik zuständig, die auch beim Spielen eines Instruments benötigt wird.
„Das Faszinierende ist: Wenn Sie aktiv Musik betreiben, wechselt das Gehirn plötzlich die Seiten!“, beschreibt Zorowka die neuronale Plastizität: Wird Musik normalerweise primär rechts verarbeitet, so ist bei Berufsmusikern die linke Seite aktiver, die sonst das Sprachzentrum darstellt. Es scheint, als würden die Bereiche für Sprachanalyse auch für die genauere Analyse der Musik verwendet.
Musikhören aktiviert aber auch Drüsen, die ihrerseits Hormone ausschütten: Langsame Musik ist stressmindernd, schnelle Musik macht durch Adrenalin-Ausschüttung aggressiv. Die Krieger bei Naturvölkern bereiteten sich auf Kämpfe vor, indem sie sich mit speziellen Tänzen in Trance begaben. Damit haben sie sich nicht nur emotional auf den Kampf vorbereitet, sondern auch der Körper war kampfbereit: Durch die Stresssituation wird unser Blut dicker, wir verbluten nicht so leicht. Durch das Adrenalin wird die Muskelfunktion schneller. Zusätzlich werden wie beim Sport Endorphine, Glückshormone, ausgeschüttet. Man könne die Endorphin-Auswirkung durch Musik sogar mit der Auswirkung von Kokain oder Sex vergleichen.
Musik wirkt
Der Reiz von Musik ist also so stark, dass er neurophysiologische Umstrukturierung bewirken kann. Die meisten Effekte sind dann zu beobachten, wenn Betroffene Musik nicht nur passiv genießen, sondern auch aktiv musizieren. Oft genügt es dazu aber, wenn jemand im Lauf des Lebens zumindest vier bis sechs Jahre lang ein Musikinstrument erlernt hat.
Musik steigert die Leistungsfähigkeit. Bei Musikern ist der Große Balken, die Verbindung zwischen den beiden Hirnlappen, größer ausgebildet; das ermöglicht einen schnelleren Abgleich der beiden Hemisphären des Gehirns und der dort verorteten Fähigkeiten. Musikalische Früherziehung wirkt sich positiv auf die intellektuelle und soziale Entwicklung von Kindern aus. Die emotionale Anregung durch Musik scheint die soziale Kompetenz zu fördern, indem die Betroffenen positiven wie negativen Stress besser steuern können. Musik verringert die Schmerzempfindung, reduziert Blutdruck und Herzfrequenz und wird deswegen in der Anästhesie unterstützend eingesetzt. Rhythmen regen Sportler zu Höchstleistungen an. Alterungsprozesse werden durch aktives Musizieren verlangsamt, sogar hochdemente Personen können mit Musik wieder ansprechbar werden. Auch autistische Personen können über Musik mit anderen Personen Kontakt aufnehmen.
Musiktherapie ist ein zunehmend bedeutender Teil bei der gesamten Hörförderung nach einer Cochlea-Implantation: Sind mit einer Musik positive Emotionen verknüpft, unterstützen diese Emotionen jegliches Lernen. Musiker haben auch im Alter ein besseres Arbeitsgedächtnis. Zudem wird mit Musik trainiert, einer Melodie zu folgen. Besonders wenn im Alltag viele Stimmen durcheinander zu hören sind, verbessert sich das Sprachverstehen, wenn der Betroffene der Sprachmelodie besser folgen kann.
Prof. Zorowka endete den Vortrag mit einem Hinweis auf spezielle Musiktrainingsprogramme und mit dem Appell: „Es ist nie zu spät, mit dem Musizieren zu beginnen, auch wenn Sie in der Jugend noch kein Instrument gelernt haben!“
Dieser Beitrag ist die Zusammenfassung eines Vortrags, der von O. Univ. Prof. Dr. Patrick G. Zorowka, Geschäftsführender Direktor der HNO-Abteilung und Direktor der Universitätsklinik für Hör-, Stimm- und Sprachstörungen der Universitätsklinik Innsbruck, im Rahmen der MED-EL Initiative HÖREN BEWEGT im Frühling 2019 im Wiener Haus der Musik gehalten wurde.